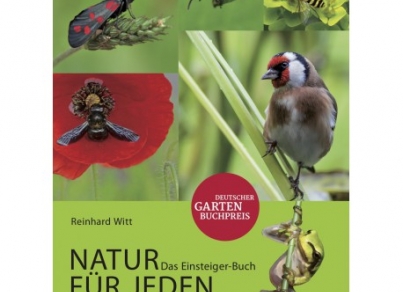Früher war mehr Vertrauen
„Wenn früher der Vorstand sagte: Jetzt gehen wir alle nach links - dann ist der ganze Verein nach links gegangen. Wenn heute ein Vorstand das sagt, kommt gleich die Frage: Warum gehen wir nicht nach rechts? - ein anderer will vorwärts und wieder ein anderer sogar zurück.“ Dieses Zitat unseres Präsidenten Klaus Otto trifft die Zustände nicht nur in unseren Vereinen, sondern in der gesamten Gesellschaft - deren Bestandteil die Vereine ja sind - wie den Nagel auf den Kopf.
Wie konnte es zu einer solchen misstrauenden Orientierungslosigkeit kommen?
Früher gab es einen gesellschaftlicher Grundkonsens, auch „Grundwerte“ genannt, der als Norm das gesellschaftliche Leben bestimmte, es gab erwünschte, erlaubte, mehr oder weniger geduldete und nicht zulässige, geächtete Verhaltensweisen, also einen Regelkodex, der von (fast) allen respektiert wurde und die Gesellschaft zumindest äußerlich zusammenhielt.
Nicht verschwiegen werden soll, dass damit auch der Heuchelei und dem Pharisäertum Vorschub geleistet, manches „Dorfgeheimnis“ nur flüsternd hinter vorgehaltener Hand garniert mit lustvoller Empörung weitererzählt wurde und Personen, die sich nicht „regelkonform“ verhielten, öffentlich geächtet und nicht selten bis in den Freitod getrieben wurden - Hauptsache, der „gute Eindruck“ konnte wenigstens nach außen halbwegs aufrechterhalten werden.
Eine wichtige „Gesellschaftsklammer“ war früher die Kirche, der gemeinsame Glaube und die Autorität der „Vertreter Gottes“ in ihren Gemeinden.
Schon in den uralten Hochkulturen z.B. in Mesopotamien und in Ägypten gab es „Staatsreligionen“. Die alten Griechen waren hier schon „freidenkerischer“, manche Philosophen hielten zwar die Götter für Menschenwerk, aber sie glaubten trotzdem - nämlich an die „Humanität“, an das „Gute im Menschen“. Bei den Römern schwang das Pendel dann wieder etwas zurück und so wurden später sogar die Kaiser teilweise noch zu Lebzeiten als „Gottheiten“ verehrt. Danach traten in Europa die „Eingottreligionen“, also vor allem Christentum und Islam geschichtsprägend in Erscheinung, der jüdische Glaube als verbindendes Fundament der drei auf Abraham zurückzuführenden Weltreligionen bestand ja schon länger, wurde jedoch vielfach verfolgt.
Unabhängig davon, ob der Gläubige an einen („beaufsichtigenden“) Gott oder an die Humanität glaubt, so gibt ihm sein Glaube doch eine „Richtschnur“ für sein eigenes Leben und das - sinnvollerweise möglichst reibungsarme - Zusammenleben mit seinen Mitmenschen.
In der heutigen, trotz allen Lippenbekenntnissen der Politik in der Realität staatlich geförderten „säkularen“ Gesellschaft ist der Glaube aus dem gesellschaftlichen Zentrum verschwunden und die Menschen daher auf sich selbst zurückgeworfen. Leere aber will gefüllt sein und dafür bieten sich heute unzählige „Aushilfsgötter“ an: Konsum auf Kosten der Mitmenschen und der Zukunft unserer Erde, Karriere auf Kosten der Kollegen und des Unternehmens, die sich in immer mehr Lebensbereiche hineinfressende Datenkrake Internet, die (un)„sozialen“ Medien, die auch die kürzeste Lücke zum Nachdenken erfolgreich mit meist sinnlosen „Messages“ zustopfen und auch die als Zukunftsmodell vielgepriesene „virtual reality“, die ja wie ihr Vorläufer - das „unbegrenzte“ Fernsehprogrammangebot - nur dafür geschaffen wird, um die Bürger in eine Scheinwelt zu entführen und so zu verhindern, dass sie zu wirklich „mündigen“, mit beiden Beinen in der Wirklichkeit stehenden Bürgern werden und der Politik auf die Finger schauen.
Der „mündige“ und „selbstverantwortliche“ Bürger wird ja von den Politikern nur bemüht, um damit zu verschleiern, dass sich „Vater Staat“ wieder ein Stück aus seiner - übrigens von seinen Bürgern finanzierten - Verantwortung zurückzieht und sie dadurch faktisch bestiehlt oder sie wieder mit etwas beglücken will, das zwar vorgeblich zu ihrem Besten sein soll, aber meist nur einzelnen Interessengruppen wirklich zugutekommt.
Dieses Spiel wird von immer mehr Menschen durchschaut und hat zu einem erheblichen Misstrauen gegenüber der Politik und ihren Repräsentanten geführt, was sich unter anderem in der immer mehr um sich greifenden, manchmal aber auch unreflektierten Kritik an politischen Entscheidungen äußert, die zudem mit einer zunehmen Verrohung in Sprache und Verhalten einhergeht. Aber auch hier war die Politik selbst das Vorbild, man denke nur an die Wortwahl bei politischen Diskussionen, bei denen schon lange nicht mehr Sachargumente, sondern allein die moralische Demontage des „politischen Gegners“ durch Verunglimpfungen oder aus dem Zusammenhang gerissenen absichtlich falsch interpretierten Zitaten zählt.
Der gesellschaftliche Grundkonsens wurde zu einer „Alles was gefällt ist erlaubt-Multikulti-Beliebigkeit“ verwässert, die gemeinschaftsstiftenden Religionen an den gesellschaftlichen Rand gedrängt und die Politik hat sich durch das Verhalten ihrer Repräsentanten selbst unglaubwürdig gemacht - wie und für wen soll in unserem Land dann noch Vertrauen aufgebracht werden?
Vertrauen gründet sich vor allem auf Verlässlichkeit, denn ich kann nur jemandem mein Vertrauen entgegenbringen, von dem ich glaube und erwarte, dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass er mein in ihn gesetztes Vertrauen nicht zu meinem Schaden missbraucht.
Und ohne Vertrauen kann es keine echte Gemeinschaft geben, in der sich jedes Mitglied auf das andere verlassen können muss.
Als uns Gartenfreunden vertrautes Gleichnis dafür könnte eine Pflanze dienen: Aus dem Boden der Verlässlichkeit ziehen die Wurzeln ihre Kraft, das Vertrauen bildet den tragenden Stängel und die lebenswichtigen Blätter, als Blüte zeigt sich die Gemeinschaft und der Same symbolisiert das Weiterverbreiten dieser Ideale in der Gesellschaft.
Ein beeindruckendes lebenspraktisches Beispiel für Verlässlichkeit, Vertrauen und Gemeinsinn bieten uns einige Siedlervereine in den schweren Zeiten während und nach dem 2. Weltkrieg:
Das Baumaterial wurde aus einer gemeinsamen Kasse finanziert, die Häuser gemeinsam gebaut - damals noch per „Hand am Arm“ mit den einfachsten Hilfsmitteln - und nach Fertigstellung unter den Mitgliedern verlost - man arbeitete vereint im Verein.
Heute einfach unvorstellbar, aber damals höchst effektiv, denn nur im Zusammenwirken vieler Kräfte und Fähigkeiten war möglich, was der Einzelne wegen unzureichenden „Vermögens“ alleine nie hätte erreichen können.
Wie viel einfacher haben wir es heute - und was könnten wir in unseren Vereinen und damit auch in der ganzen Gesellschaft alles bewegen, wenn wir nur einen Bruchteil der damaligen Anstrengungen einsetzen würden - und des damaligen Vertrauens!
Auf jede und jeden von uns kommt es nämlich an: Lassen wir uns nicht von „Rattenfängern“ welcher Art auch immer entmündigen, denken wir wieder konstruktiv-kritisch, besinnen wir uns wieder auf Glaube und Werte und schaffen damit eine neue und solide Basis für Verlässlichkeit und gegenseitiges Vertrauen - und dann wird auch in unseren Vereinen der Gemeinsinn wieder blühen und seine Samen in die Gesellschaft tragen - sie hat ihn heute nötiger als jemals zuvor.
Harald Schäfer
Landesfachberater